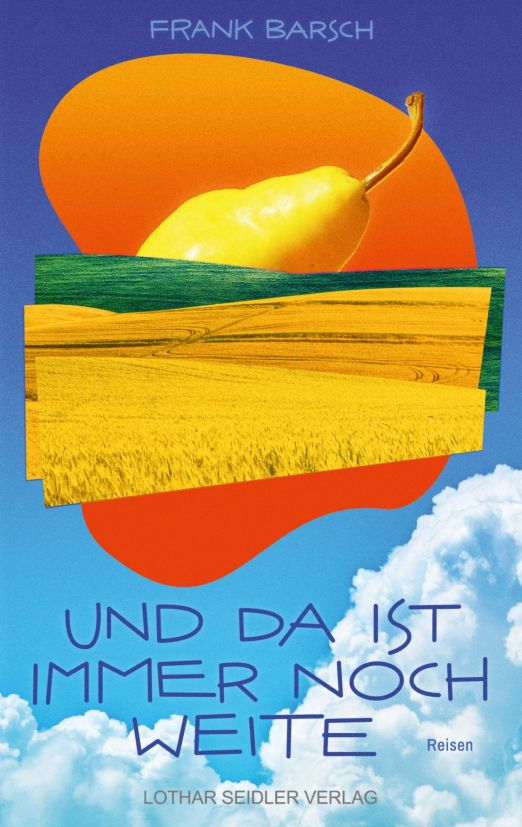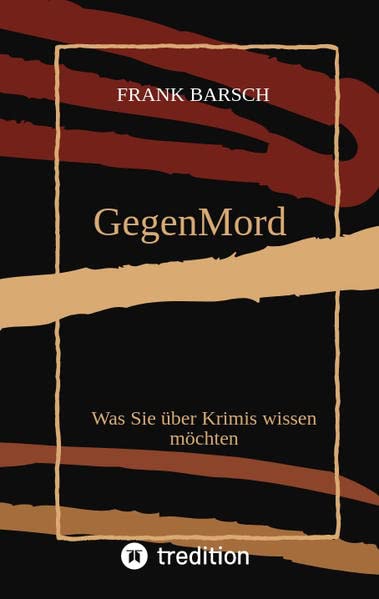Ohne Kontext, ohne Ziel /
Die Welten, die in klassischen Dystopien beschrieben werden, hängen oft seltsam in der Luft. Sei es in „Wir“, „Schöne Neue Welt“, „1984“ oder „Fahrenheit 451“. Die Gesellschaften sind einfach da. Ihre perfekt funktionierenden Unterdrückungsapparate scheinen aus dem Nichts zu kommen. Was vorher geschah, liegt im Dunklen.
Zutaten für eine klassische dystopische Welt sind: Fälschung der Geschichte, lückenlose Überwachung, Anpassung, Opportunismus, Unbildung. Eine Mischung aus Angst und Paranoia ist das alltägliche Lebensgefühl. Wer aus der Reihe tanzt, wird umerzogen oder verschwindet. Aber warum ist das so? Wer hat einen Vorteil davon? Die Herrschaft in diesen Geschichten ist oft seltsam anonym, fast unsichtbar. Hat sie ihren Zweck ausschließlich in sich selbst? Ein Perpetuum Mobile? Meist wird am Ende aus der Führungsetage eine Erklärung nachgeliefert: Die schöne neue Welt musste so werden, wie sie jetzt ist, weil sie sonst unberechenbar geworden wäre.
In was für einer Realität leben wir? Einer berechenbaren oder unberechenbaren? Oder ist sie beides zugleich? Steigt mit der Zunahme der Unberechenbarkeiten die Wahrscheinlichkeit für einen Umschlag in eine totale Berechnung? Hier das disruptiv-dystopische Chaos, dort die totale Überwachung. Dazwischen die Angst und das Argument, dass nur Unterwerfung und Überwachung das drohende Chaos verhindern können.