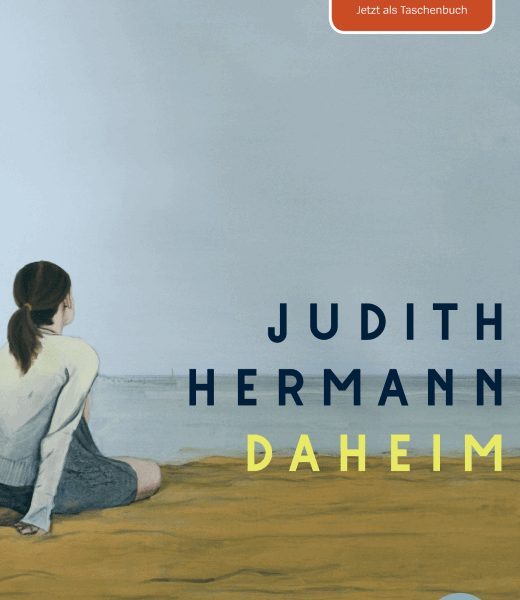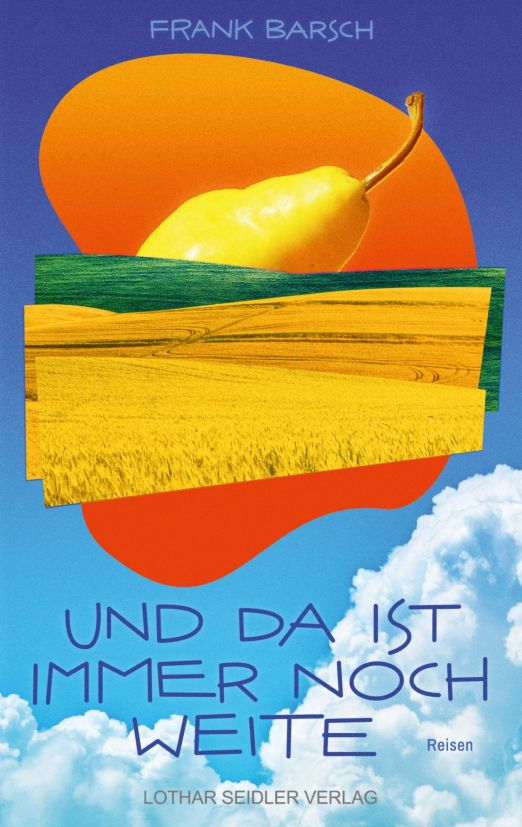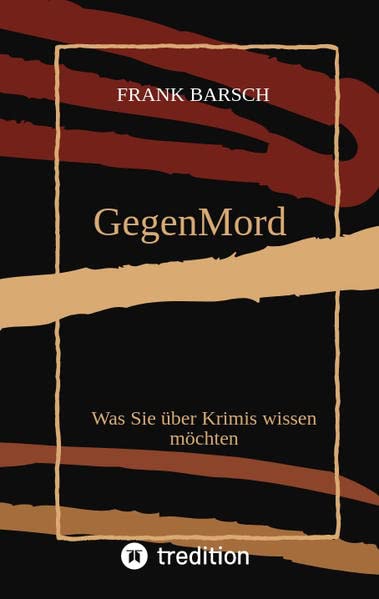In Hermanns Welt /
Das Dorf ist in. Zumindest in der Literatur. Mit „Vor dem Fest“ entwirft Saša Stanišić ein Dorf aus viel Magie und Mythen. Er sympathisiert mit den von ihm erfundenen Bewohnern. Auch Dörte Hansen versteht es, in „Altes Land“ zwischen Apfelplantagen ganz viel Schicksal und Weltbilder unterzubringen.
Wer angesichts solcher Erzählungen vielleicht schon mit dem Gedanken spielt, dass auf dem Dorf im Gegensatz zur Stadt die wahren, authentischen Menschen leben, hat die Rechnung ohne Juli Zeh gemacht. In „Unterleuten“ betrachtet sie ihre Dorfbewohner wie Versuchstiere in einem definierten Raum. Alles ist perfekt arrangiert: ihre Soziologie, ihre Position in der Zeitgeschichte, ihre Psychologie, die Beobachtungsgabe der Autorin und ihre sprachliche Genauigkeit. Juli Zehs Figuren haben Ziele, Interessen, Begierden und nehmen damit eine Position in dieser Welt ein. Sie sind Strategen, Aktive, permanent in Intrigen zur Durchsetzung ihrer Absichten verstrickt. Sie suchen den eigenen Vorteil und finden ihn auf einem mittleren oder gehobenen sozialen Niveau. Da in Unterleuten alle maßgeblichen Personen aus diesem Holz geschnitzt sind, ist die Handlung ein gigantischer Konflikt, ein unendliches Manövrieren, eine nicht zu befriedende Feindschaft. Der Gott dieses Gemetzels heißt Strategie. Wer sich heute als Gewinner wähnt, wird von der Angst getrieben, er oder sie könnte morgen zu den Verlierern zählen.
Ganz anders in Judith Hermanns Roman „Daheim“. Anfangs sieht man die Figuren in einem mit wenigen Strichen skizzierten Dorf, das direkt hinter dem Deich liegt, wie durch ein umgedrehtes Fernglas. Gestrandete, Vereinzelte ohne Ziele, die langsam zusammenrücken und ein stillschweigendes Verständnis füreinander entwickeln. Biografien aus Lücken und Andeutungen. Sozial begnügen sie sich mit wenig, ihr Leben besteht nicht aus Besitz oder Vermögen, sondern aus Beziehungen. Eins haben sie gemeinsam, sie sind in ihren Familiengeschichten gefangen. Und die sind wiederum Teil eines größeren Ganzen aus unausgesprochenen Zwängen und Strukturen. In dieser Welt stehen Einzelgänger vor der Alternative, mitzulaufen oder doch lieber ein eigenes Leben zu leben. Während in Juli Zehs Unterleuten alles Bewegung und Kampf ist, handelt Daheim von Menschen, deren Passivität und Eigensinn in etwas Positives umschlägt: eine Befreiung in kleinen Schritten, die kaum erkennbar und großartig zugleich ist.
Unter dem Strich also zwei Dorfromane mit zwei Welt- und Menschenentwürfen, die unterschiedlicher nicht sein können. Das führt zu einer Frage über die Rolle und Wirkung von Literatur: Was passiert, wenn ich die Welt so sehe, wie Juli Zeh sie präsentiert? Als pausenlose Konkurrenz, als erweiterte Kampfzone? Oder als etwas, das auf mich zukommt und das ich annehmen kann, wie bei Judith Hermann? Funktioniert der eine Roman als realistisches Abbild mit satirischer Warnung, der andere als Modell eines geduldig-melancholischen Ankommens? Anders gefragt: Kann ich mich für eine dieser Sichtweisen auf die Welt entscheiden? Kann Literatur Weltanschauungen beeinflussen, das Selbst- und Weltbild der Leser:innen verändern. Und damit deren Verhalten und Handeln?
Klar, Judith Hermanns Roman wirkt etwas esoterisch und erinnert an Filme von Aki Kaurismäki. Doch im Gegensatz zu Juli Zehs Schlachtengemälde enthält ihre Erzählung die Möglichkeit einer Entwicklung. Die Figuren gehen von sich selbst aus, nicht von dem, was man halt so macht, wenn man Besitz, Erfolg und Einfluss haben will. All das spielt in Hermanns Welt keine Rolle. Dadurch entsteht ein exemplarischer Raum, eine Weite mit einer Tendenz zur Freundschaft.
Juli Zeh (2016): Unterleuten. Roman. Luchterhand Verlag
Judith Hermann (2021): Daheim. Roman. S.Fischer Verlag