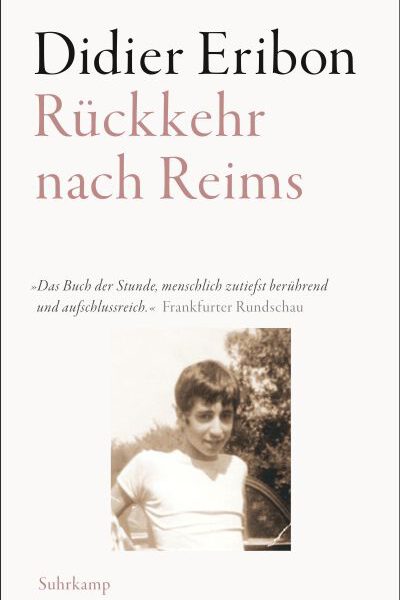Auf dem Weg zum Ungehorsam – Gedankensprünge mit Didier Eribon /
Mit „Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben“, das 2024 auf Deutsch erschienen ist, hat der französische Soziologe und Intellektuelle Didier Eribon eine Fortsetzung seines Bestsellers „Rückkehr nach Reims“ geschrieben. Ging es dort um die Fragen, die sich nach dem Tod seines Vaters stellten, handelt die Fortsetzung vom Leben der Mutter.
Neben einem Überblick über die Klassenlagen der französischen Nachkriegszeit sind es die Bezüge, zur Gegenwart, die Eribons „Rückkehr nach Reims“ interessant machen. Das Buch ohne Gattungsbezeichnung ist 2009 herausgekommen und 2016 auf Deutsch erschienen. In der Zwischenzeit hat in Frankreich Édouard Louis das Erzählmuster und den Stoff für sein autofiktionales Romandebüt „Das Ende von Eddy“ (En finir avec Eddy, 2014) erfolgreich aktualisiert. Annie Ernaux ist vielleicht die berühmteste Vorläuferin dieser Form des autobiografischen Schreibens.
Abtönung zwischen Kleinbürgern und Bürgertum
In der deutschsprachigen Literatur ist die Darstellung von sozialen Prägungen durch die Herkunft, abgesehen von Migrationshintergründen, eher ein Nischenprodukt. Eine Ausnahme ist Anke Stellings 2018 erschienener Roman „Schäfchen im Trockenen“. Darin sucht Resi, die Hauptfigur, Gründe dafür, warum sie plötzlich nicht mehr mit den Freunden klar kommt, mit denen sie aus der Provinz nach Berlin gegangen ist. Sie findet sie im Klassenunterschied. Bei Stelling geht es nicht wie bei Eribon und Louis um den „gespaltenen Habitus“ eines Arbeiterkindes, dass sich durch Bildung einen neuen sozialen Status erkämpft, sondern um die Abtönungsfragen zwischen Kleinbürgern und Bürgertum, die in der Form von schichtspezifischen Lebensentwürfen, Erfolgsgewissheiten und unterschiedlichen Formen des Selbstbewusstseins in Berlin Mitte aneinandergeraten.
In den 70er Jahren, als die Klassenfrage auch in der Literatur auf der Tagesordnung stand, ist Martin Walser der Frage nachgegangen, was für ein Selbstbewusstsein dieses Kleinbürgertum hat. Historisch verfolgte er die Spuren des bürgerlichen Goethe auf dessen „Wallfahrt zum Adelsdiplom“ über Thomas Mann und Franz Kafka bis zu sich selbst. Mit seiner Poetikvorlesung „Selbstbewusstsein und Ironie“ entwarf er 1981 ein literarisches Programm zur Bewusstmachung der damit verbundenen Selbstbilder.
Wie Eribon arbeitete auch Walser daran, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die in einer Gesellschaft der feinen Unterschiede auftretenden Selbstzweifel und die damit verbundene Scham, kein individuelles Versagen sind, sondern auf soziale Prägungen zurückgehen. Die Arbeiterklasse und das Kleinbürgertum unterschieden sich im 20. Jahrhundert darin, dass die Arbeiterbewegung mit Gewerkschaften und Parteien, eine kollektive Perspektive hatte und so über ein Klassenbewusstsein aufgewertet wurde, während das Kleinbürgertum durch dessen berufsbedingte Vereinzelung und dem Versuch, sich von den Arbeitern und Arbeiterinnen abzuheben, keinen Anschluss an eine Organisation finden konnten, die ihm einen Interpretationsrahmen für einen eigenen reflektierten positiven Status und eine Utopie für eine mögliche Entwicklung anbot.
Der 1953 geborene Didier Eribon schreibt in „Rückkehr nach Reims“ über die Erinnerung an die Orte seiner Kindheit:
„Wie James Baldwin kam ich zu dem Schluss, das alles, was mein Vater war, was ich ihm vorwerfen und wofür ich ihn gehasst hatte, von der Gewalt der sozialen Verhältnisse geformt war. Er war stolz, der Arbeiterklasse anzugehören. Später war er stolz, sich zumindest ein klein wenig über diese Verhältnisse erheben zu können … Das Leben meines Vaters, seine Persönlichkeit und Subjektivität wurden von einer doppelten Einschreibung in einen Ort und eine Zeit bestimmt, deren Härten und Zwänge sich wechselseitig verstärkten. Der Schlüssel zu seinem Sein: wo und wann er geboren wurde. Ein Segment des sozialen Raums und der historischen Zeit entschied darüber, welchen Platz er in der Welt einnehmen, wie er die Welt entdecken und welchen Weltbezug er aufbauen konnte. Sein beinahiger Wahnsinn und die daraus resultierende Beziehungsunfähigkeit hatten letztlich wenig Psychologisches im Sinne eines individuellen Charakterzuges. Sie waren Folgen eines präzise situierten In-der-Welt-Seins.“ (S. 30 f)
Ist das bei uns allen so? Beherrschen wir unser Leben gar nicht so, wie wir es glauben? Und was bedeutet das in einer Zeit und Gesellschaft, die alles individualisiert? Dein Aufstieg und dein Scheitern, dein Erfolgsbewusstsein und deine Scham: Alles, heißt es, liege in deinen Händen. Erfolgreich ist, wer immer wieder aufsteht. Was aber, wenn viele in ihrer Kindheit gar nicht lernen, wie man das macht? Ein weiterer Nachteil der Vereinzlung, die als Freiheit deklariert wird, liegt auf der Hand: Menschen, die sich für alles selbst die Schuld geben und permanent in Scham leben, tun sich nicht mit anderen zusammen, denn Scham ist ein Gefühl, das den Wunsch nach sich zieht, sich zu verbergen. Zumindest so lange, bis die Wut die Oberhand gewinnt.
In den sechziger und siebziger Jahren, so Eribon, teilte sich die Welt aus der Perspektive der Arbeiter:innen in zwei Lager: Wir, die kleinen Leute, die Linken, die Partei und die, Reiche, Mächtige und Rechte, die alles kontrollieren.
„Auf der einen Seite das Wir und das Mit uns, auf der anderen das Sie und das Gegen uns. Wer erfüllt heute die Funktion, die damals die Partei innehatte? Von wem dürfen sich die Ausgebeuteten und Schutzlosen heute vertreten fühlen? An wen wenden und auf wen stützen sie sich, um politisch und kulturell zu existieren und Stolz und Selbstachtung zu empfinden, weil sie sich legitim, da von einer Machtinstanz legitimiert, fühlen? Oder ganz schlicht: Wer trägt der Tatsache Rechnung, dass sie existieren, dass sie leben, dass sie etwas denken und wollen?“ (S. 39)
Hat Elon Musk diese Rolle übernommen? Oder die Influencer auf Tiktok? Die CDU und die FDP? Wer soll das überhaupt sein, die Ausgebeuteten und Schutzlosen? Hier gibt es keine Ausbeutung, schließlich haben wir Mindestlohn! Wer Reichtum kritisiert, heißt es, schüre Neid. Das ist immerhin eine Todsünde. Die Tauschlogik funktioniert nun mal so. Was soll man da machen? Anders gesagt: Während die Ausgebeuteten, die es angeblich nicht gibt, keine Interessenvertretung mehr haben, organisieren sich die Anderen, wo es nur geht.
Doch wer sind Wir tatsächlich? Wie die Romane von Goethe, Martin Walser und Anke Stelling zeigen, fühlen sich auch Bürger und Kleinbürger ausgebeutet. Und schämen sich dafür. Wenn sich aber fast alle schämen, wer hat dann einen davon Vorteil? Oder ist das einfach die zynische Konstruktion eines bösen Gottes?
Eribon fährt fort:
„Das Wort Ungleichheit ist eigentlich ein Euphemismus, in Wahrheit haben wir es mit nackter, ausbeuterischer Gewalt zu tun. Der Körper der alternden Arbeiterin führt allen die Wahrheit über die Klassengesellschaft vor Augen.“ (S. 78)
Die Zerstörung des Körpers war auch bei Bauern, Handwerkern und Alleinunternehmern üblich, in Bereichen, in denen die Selbstausbeutung vorherrschte, hinter der sich genau genommen wieder eine Ausbeutung durch „die“ verbarg. Ralf Rothmann hat in „Milch und Kohle“ (2000) und „Nacht unter dem Schnee“ (2022) über die Ausbeutung der Körper seiner Eltern geschrieben. In seinem Roman wird auch noch etwas anders deutlich: Die maximale Form dieser Ausbeutung ist der Krieg.
Zurück zur Literatur
„Interesse an Kunst oder Literatur hat stets, ob bewusst oder unbewusst, auch damit zu tun, dass man das Selbst aufwertet, in dem man sich von jenen abgrenzt, die keinen Zugang zu solchen Dingen haben; es handelt sich um eine Distinktion, einen Unterschied im Sinne einer Kluft, die konstitutiv ist für das Selbst und die Art, wie man sich selbst sieht, und zwar immer im Vergleich zu anderen – den bildungsfernen oder unteren Schichten etwa.“ (S. 98)
Gibt es auf diesem Feld auch andere Erfahrungen? Für mich war Literatur ein Ausweg aus der Welt, in der ich lebte. Eskapismus ist gerade ein gern verwendeter Begriff. Habe ich deshalb Literatur studiert? Ich glaube nicht, dass es mir in erster Linie um Unterscheidung ging, sondern um das Versprechen, dass es über Literatur einen ganz speziellen Zugang zu einer bestimmten imaginären Welt und Wahrheit gibt. Literatur war und ist für mich ein Medium der Selbsterkenntnis. Die wurde mir in der Familie nicht so zuteil, wie es wünschenswert gewesen wäre. Vieles, was andere Kinder und Jugendliche vielleicht durch ihre Eltern erfahren, erfuhr ich durch Bücher. Aber es ging darüber hinaus, ich erfuhr auch Dinge, die ich von meinen Eltern nicht erfahren konnte, weil sie ihnen gar nicht bewusst waren.
Ist der daraus folgende Versuch der Emanzipation schon Distinktion? Später machte ich noch eine andere Erfahrung: In der Kleinstadt, in der ich aufwuchs, hatte ich keinen Kontakt mit höheren Schichten, auch keine Anschauung von denen. Ein paar Lehrer, der Pfarrer, Geschäftsleute. Doch während ich das schreibend behaupte, fällt mir ein, dass mich mein Vater in den Schützenverein steckte. Dort sollte ich die wichtigen Leute des Städtchens kennenlernen. Das führte dazu, dass ich die, die dort Mitglieder waren, als wichtig wahrnahm. Allerdings konnte ich vor lauter Hemmungen die Mission, die mein Vater für mich vorgesehen hatte, nicht erfüllen. Zudem war ich mit Abstand der jüngste in diesem Verein. Obwohl ich das mit dem Schießen sehr gut hinbekam, hatte ich vom ersten Tag an das Gefühl, nicht dazuzugehören.
Aber gut, von den Schusswaffen zurück zur Literatur und zu Kunst. Meine Ablösung von meinem kleinbürgerlichen Milieu hatte die Form einer Springprozession: Zwei Schritte vor, einen zurück. Das Gymnasium und die mies bezahlten Ferienjobs. Das Abitur und danach die Arbeit in einer Fabrik, im Tagebau und dann als Anstreicher. Der Umzug in die berühmte Universitätsstadt Heidelberg und meine Lehre als Bäcker. Erst als mir danach, als jemand, der etwas gelernt und damit einen Anspruch auf einen gewissen Respekt hatte, die Arbeitsverhältnisse immer noch auf die Nerven gingen, entschloss ich mich zum Studium. Mit diesem Entschluss hatte sicher auch die Stimmung der siebziger und achtziger Jahre zu tun, die Bildungsreform, durch die viele wie ich über Bafög die Möglichkeit bekamen zu studieren. Geld, das man später zurück zahlen musste. Und bestimmt ist etwas anderes nicht ganz unwichtig: An einer Universität gibt es mehr Frauen als in einer Bäckerei.
Neben meinem Studium begann ich zu schreiben. Literatur und Schreiben blieben für mich eine Methode der Emanzipation. In der Literaturgeschichte entdeckte ich meine eigene Geschichte, vom Schelmenroman zum Bildungsroman, aber ich entdeckte auch die Schönheit der Sprache. Aber zurück zum Thema, es ging um Distinktion. Ich schrieb Theaterkritiken für ein Stadtmagazin. Das war nicht die große bürgerliche, sondern eine alternative Presse. Auch eine Distinktion, aber nach meinem Muster: einen Schritt vor und dann verharren. Im Theater traf ich nun auf das bürgerliche Publikum, das sich bürgerliche Geschichten vorführen lies. Das Theater als Selbstbestätigungsmaschine, wie sie auch die Literatur sein kann, wenn sie als Distinktionsmedium gebraucht wird. Im Theater fühlte ich mich nur wohl, wenn das Licht aus war und gespielt wurde. Im Foyer kam ich mir fehl am Platz vor, hier gehörte ich nicht hin. Die Leute waren die andern, die die gegen mich waren. In der Arbeitswelt hatte ich sie kennengelernt, als Arbeits- oder Auftragsgeber oder als Kunden. Und, da hat Didier Eribon Recht, das war in mich sozial eingeschrieben. Die Reaktion nennt man Ressentiment, ein Begriff, in dem die Abwertung derer mitklingt, die ihn benutzen, um mich damit zu charakterisieren. Doch handelte es sich bei mir offenbar um ein gespaltenes, kleinbürgerliches Ressentiment. Auf der einen Seite die Ablehnung der Anderen auf der anderen Seite die Unterordnung unter deren angebliche Überlegenheit und Autorität.
Kunst und Literatur waren zweierlei
Damit rundet sich der Gedanken ab. Kunst oder Literatur war für mich zweischneidig, ein Instrument der Selbsterkenntnis und gleichzeitig eine Sphäre, zu der ich nicht gehörte. Das hat sich auf gewisse Weise bis heute durchgezogen. Ich habe in Literaturwissenschaften promoviert, unterrichte und schreibe Literatur, aber fühle mich immer noch von dem sozialen Milieu, zu dem Literatur und Kunst gehören, ausgeschlossen. Ich glaube, dass mein Unterricht und meine Literatur eine gewisse Qualität haben, kann mir aber nicht vorstellen, dass sie jemals eine Anerkennung erfahren, die dem halbwegs entspricht. Andererseits, wie komme ich überhaupt auf die Idee, das irgend twas, das ich tue, Anerkennung erfahren könnte?
Im vierten Kapitel von „Rückkehr nach Reims“ beschreibt Eribon sein Studium. Am Ende des Kapitels meint er, dass es nicht möglich ist, eine Doktorarbeit zu schreiben und gleichzeitig seinen Lebensunterhalt zu verdienen. „Man wird sie nicht schreiben; die Brotarbeit raubt einem alle Zeit und Kraft.“
In meinem Fall kann man Brotarbeit wörtlich nehmen. Nachdem mein Bafög ausgelaufen war, habe ich in meinem Beruf gearbeitet. Anfangs ging ich nach dem Backen an die Uni oder schrieb an meinen Arbeiten. Aber das funktionierte nicht. Ich richtete mir zwei Leben ein, die Tage, an denen ich Brot buk und die Tage, an denen ich studierte und an der Dissertation schrieb. Für mich war das normal. Das es nicht normal war, wurde mir erst klar, als ich sah, wie viele ihre Dissertation abbrachen.
Aber die Textstelle bei Eribon geht weiter:
„Der wahre Wert eines Hochschulabschlusses hängt vom sozialen Kapital ab, auf das man zurückgreifen kann, und von dem strategischen Wissen darüber, wie man einen solchen Abschluss auf dem Arbeitsmarkt einsetzt. In solchen Fällen kommt es auf die Hilfe der Familie an, auf Beziehungen, auf ein Netzwerk von Bekannten usw. Ohne solche Zutaten kann man den Wert eines Abschlusses gar nicht ausschöpfen. Soziales Kapital hatte ich allerdings kaum vorzuweisen. Genauer gesagt: Ich hatte gar keines. Über strategisches Wissen verfügte ich auch nicht. Mein Diplom war also nichts wert, oder jedenfalls sehr wenig.“ (S. 187)
Leben in zwei Welten
Für mich stellt sich die Frage, wo mich die Literatur hingeführt hat. Hätte ich als Bäckermeister nicht ein wohlhabenderes Leben geführt? Heute wird gutes Brot gerade wieder zu einem Statussymbol, ja fast zu einer Kunst erhoben. Bin ich zufrieden als Literaturwissenschaftler und Schriftsteller? Ich glaube, ich bin immer noch in der gleichen Situation, ich lebe in zwei Welten. Ich schreibe und arbeite und beziehe daraus mein Selbstbewusstsein, obwohl oder weil das, was ich mache, kaum symbolische oder ökonomische Anerkennung erfährt. Ich weiß, ich müsste dafür kämpfen. Ich habe es immer mal wieder versucht, habe es aber nie auf die andere Seite geschafft. Vielleicht ist die, so wie ich geprägt bin, für mich einfach nicht zugänglich. Ich bin nicht Didier Eribon oder James Baldwin. Aber auch damit bin ich nicht allein. Rückblickend, denn um einen Rückblick geht es ja auch bei Eribon, frage ich mich, wie ich mein Leben einordnen soll und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die Zukunft ergeben.
Sicher sind meine Persönlichkeit und Subjektivität von einer doppelten Einschreibung in einen Ort und eine Zeit bestimmt. Es ist unbestreitbar, dass der mir eingeschriebene Habitus und die ebenfalls eingeschriebenen Wünsche, ein anderes Leben zu leben, Scham und Unzufriedenheit erzeugen. Ich bin oft unzufrieden gewesen und bin es immer noch. Aber war das immer und ständig so? Als ich mit zwanzig in einem Malerbetrieb gearbeitet habe, war ich zufrieden unter Handwerkern und Arbeitern. Auch als Bäcker war ich zufrieden, vor allem die fast zehn Jahre während des Studiums und der Promotion, die ich in einer der ersten ökologischen und selbstverwalteten Bäckereien in Deutschland gearbeitet habe. Ich weiß, die Attribute ökologisch und selbstverwaltet weisen über den üblichen „Bäcker-Habitus“ hinaus. Auch wenn mir die Promotion wirtschaftlich und sozial nicht das gebracht hat, was ich mir erträumte, bin ich mittlerweile doch ganz zufrieden. Es kann aber auch sein, dass ich einfach nicht mehr unzufrieden sein will.
Warum fühlt man sich minderwertig gegenüber denen , die es zu mehr gebracht haben?
Vielleicht übersieht Eribon eine Frage: Warum sollte man nicht mit etwas zufrieden sein, auch wenn es den Statusanforderungen der Gesellschaft nicht entspricht? Warum fühlen sich „Ungelernte“, Arbeiter:innen, Handwerker:innen, Angestellte minderwertig gegenüber denen, die es zu mehr gebracht haben, warum ist das beim Bürger gegenüber dem Adel und dem Kleinbürger gegenüber dem Bürger genauso? Mehr bedeutet in erster Linie eine höhere Position in der ökonomischen Hierarchie und mehr Rechte mitzusprechen, zu entscheiden, am kulturellen Leben teilzuhaben und die Weise, wie man angesehen wird. Ehre ist das Ansehen, das man genießt.
Diese Hierarchien und dieser antizipierte fremde Blick schreiben uns automatisch ein bestimmtes Streben und Begehren ein. Kann ich mich von dieser Einschreibung lösen? Ist ein anderes System denkbar? Es geht mir darum, diese Fremdbestimmung durch eine Selbstbestimmung zu ersetzen. Das war ein Ziel der Arbeiterbewegung. Wenn aber diese Habitusprobleme eine bestimmte Ideologie widerspiegeln, kann es kein richtiges Leben in dieser falschen Ideologie geben. Jeder Aufstieg ist dann nicht nur ein gefühlter Verrat an der eigenen Klasse, sondern ein echter gemessen an der Ideologie, die man dabei übernimmt. Wäre es dann soziologisch nicht interessant, die Bewegungen zu untersuchen, die sich jenseits dieser Ideologie verstehen? Ist es nicht zu einfach, die Hippies als Mode abzuwerten, die nur in einem kapitalistischen System möglich war oder die frühen Grünen, die ein anderes Gesellschaftssystem durchsetzen wollten, als fundamentalistische Spinner abzutun? Sind die globalen Probleme nicht ein Folge dieses Systems und der gegenwärtige Rechtsruck der Versuch, dieses System gegen jede Vernunft zu betonieren?
Aber zurück zu mir. Das Gesellschaftssystem, in dem ich lebe, tut alles, um mich unzufrieden zu machen und behauptet gleichzeitig, es sei die beste aller Welten, eine alternativlose Welt, denn außerhalb von ihr lauere das Böse. Früher begann dieses Reich ein paar hundert Meter von meinem Elternhaus entfernt, an der Grenze zu DDR. Aber jetzt lebe ich in Heidelberg, in gut einer Stunde bin ich in Frankreich. Die „Rückkehr nach Reims“ bringt mich zu folgendem Gedanken: Henry David Thoreau hat den Begriff des „zivilen Ungehorsams“ geprägt. Es geht darum, etwas, dass der Staat oder die Gesellschaft verlangt, nicht zu tun. Zum Beispiel freitags nicht zur Schule zu gehen und in einen Streik zu treten. Vielleicht lässt sich diese Handlungsweise durch etwas ergänzen, dass sich auf das Verhalten bezieht. Wäre nicht auch ein habitueller Ungehorsam denkbar. Sicher, so eine Immunisierung gegen die Tausch- und Distinktionslogik erfordert ziemlich viel Reflexion und auch ein bisschen Selbstlosigkeit. Aber das würde vieles verändern.
Didier Eribons (2009 / 2016) Rückkehr nach Reims
Ralf Rothmann (2000): Milch und Kohle
Ralf Rothmann (2022): Die Nacht unterm Schnee
Martin Walser (1981): Selbstbewusstsein und Ironie.
Édouard Louis (2014): Das Ende von Eddy
Anke Stelling (2018): Schäfchen im Trockenen.
Johann Wolfgang von Goethe (1795) Wilhelm Meister